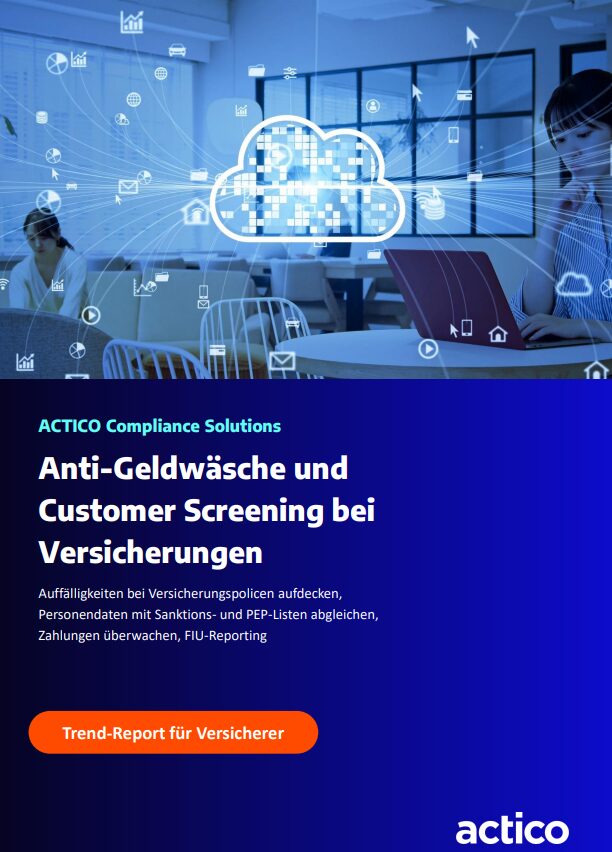News
ACTICO als „Leading Decisioning Platform 2025“ beim Elets NBFC 100 Tech Summit ausgezeichnet
ACTICO wurde beim Elets NBFC 100 Tech Summit als Leading Decisioning Platform 2025 ausgezeichnet und stärkt damit seine Position im Bereich skalierbarer Kreditentscheidungsplattformen für NBFCs und Finanzdienstleister in APAC.
Retail Lending
Finanzdienstleister ohne Banklizenz
Awards & Recognitions